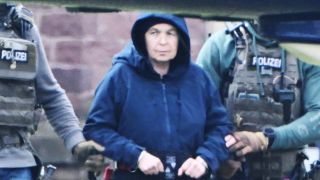Interview | Historiker Christoph Kreutzmüller - "Ein Deportationsbild sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen"

Wie sah es aus, als Jüdinnen und Juden vor den Augen ihrer Nachbarn von Polizisten abgeholt und deportiert wurden? Aus Berlin gibt es nur Berichte, keine Bilder. Das Haus der Wannseekonferenz hat einen Aufruf gestartet - doch die Suche ist schwierig.
rbb|24: Herr Kreutzmüller, vor etwa zwei Jahren haben Sie mit dem Haus der Wannseekonferenz mit der Aktion "Uns fehlt ein Bild" dazu aufgerufen, Fotos aus Berlin einzuschicken, wo man sieht, wie Berliner Juden zu ihrer Deportation gebracht werden. Wie viele Bilder wurden eingeschickt?
Christoph Kreutzmüller: Es ist kein einziges Bild eingeschickt worden. Ich habe zwar Hinweise bekommen, teilweise auch von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Menschen, die etwas gesehen hatten, teilweise als Kinder, haben sich gemeldet. Aber Bilder haben wir leider immer noch nicht.
Aus anderen Städten gibt es diese Bilder. Warum ausgerechnet aus Berlin nicht?
Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die Frage, also der Aufruf dazu, von uns falsch gestellt wurde. Wir haben nicht klar genug formuliert, dass ein Deportationsbild nicht unbedingt wie ein klassisches Deportationsbild aussehen muss. Unter einem klassischen Deportationsbild stellen sich die meisten wohl eine Straßenszene vor, wo eine große Gruppe mit gelben Sternen mit großen Gepäckstücken entlangzieht und dabei bewacht wird, am besten direkt am Bahnhof. Doch so einfach ist es nicht immer.
Wer hat die Bilder aus anderen Städten überhaupt gemacht? Stramme Nazis, die sich daran ergötzt haben oder Menschen, die diese unfassliche Situation dokumentieren wollten – oder im Zweifelsfall beide?
Die meisten Bilder sind damals von Polizisten gemacht worden. Jede Polizei hatte einen Erkennungsdienst, der normalerweise für diese Porträtfotos von vorn und der Seite zuständig war. Sie hatten also Kameras und waren damals angehalten zu dokumentieren, wie ordentlich die Polizei auch da gearbeitet hat. In Würzburg, das wissen wir, gab es eine Sekretärin, die die Fotos sorgfältig in ein Album eingeklebt und beschriftet hat. Mit Bildunterschriften wie "Muss i denn zum Städtele hinaus".
Für Berlin ist da leider ganz wenig überliefert. Auch weil es sehr wenig Akten der Kriminalpolizei oder der Gestapo aus dieser Zeit gibt. Dabei sind aus Berlin über 100 Transporte losgegangen. Das wird die Polizei wahrscheinlich schon fotografiert haben. Doch diese Akten sind vernichtet worden oder verbrannt.
In manchen Städten haben die Stadtverwaltungen diese Situationen auch als Ereignisse für ihre Kriegschronik fotografiert. Mitunter haben auch Parteibonzen oder deren Kinder Fotos gemacht.
In ganz wenigen Fällen gibt es aber auch Fotos, die heimlich gemacht wurden.
Und auch da gibt es keine aus Berlin?
Nein. Die meisten, die wir kennen, sind eher aus kleineren Städten. Dort kennen die Leute einander und jemand, der bekannt war konnte, leichter Fotos machen. In Berlin durfte ganz wenig fotografiert werden, weil das Regime Angst hatte, dass die Fotos ins Ausland gelangen. Wenn man damals in Regensburg beispielsweise Fotos gemacht hätte, hätte das gedauert, bis das Bild seinen Weg in eine internationale Presseagentur gefunden hätte. In Berlin saß die Associated Press immer noch da. Und nach 1942 wenigstens noch die schwedische Zeitung.
Zudem kommen in kleineren Städten auch heutzutage die Archive leichter an die Fotos der Bewohner heran – oder die Bewohner sagen von sich aus, dass sie Bilder haben. In Bruchsal beispielsweise hat mal jemand einen Film vor das Haus des Bürgermeisters gelegt. Sowas ist in Berlin schwer vorstellbar.
Aus Brandenburg hingegen gibt es Bilder. Sogar mehr als bislang bekannt. Das hat eine Anfrage beim Stadtarchiv der Stadt Brandenburg ergeben.
Hatten zu dieser Zeit überhaupt schon viele Menschen Kameras?
Etwa zehn Prozent der Bevölkerung hatten um 1939/40 eine Kamera. Das waren eher junge Bürger. Denn Fotografie war ja etwas neues. Aber gerade in den Städten gab es also schon relativ viele Kameras.
Was genau hätten Sie mit den Bildern vorgehabt?
Wir würden entsprechende Fotos aus Berlin gerne analysieren und in den Unterricht einbringen. Im Haus der Wannseekonferenz arbeiten wir ja pädagogisch mit Fotografien. Für das Projekt #LastSeen würde ich sie auch sehr gern in den digitalen Bildatlas, den wir planen, einarbeiten. Fände man mehrere Fotos wäre das auch eine Ausstellung wert.
Nun gibt es aktuell einen neuen Bild-Aufruf namens #LastSeen des Arolsen Archive, bei dem Sie auch wieder beteiligt sind. Was ist hier das Ziel?
Hier suchen wir Fotos wirklich aller Deportationen. Die der Juden, aber auch der Sinti und Roma und der Krankentransporte. Oder derjenigen, die als krank deportiert wurden. Wir wollen einen digitalen Bildatlas zu erstellen. Und für diesen wird es dann eine Detailanalyse für Schülerinnen und Schüler geben. Die Aktion ist am 20. Januar in München gestartet mit einem historischen Lastwagen, der über die Dörfer und die kleinen Städte fährt.
Kommt der Laster auch nach Berlin und hoffen Sie da auf neue Bilder aus Berlin?
Ja, der Laster kommt im Februar auch nach Berlin. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt Bilder hinzukommen. Wir müssen nur unsere Suche sozusagen verfeinern. Damit die Menschen nochmal genau nachschauen können.
Für das Projekt #LastSeen haben wir angefangen, alle 550 bis 600 Fotos, die es bislang in Deutschland zu diesem Thema gibt, zu sichten. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Fotos nicht immer so aussehen, wie man das denken würde. Aus Dortmund gibt es beispielsweise ein Foto, das eine Gruppe von Menschen zeigt, die sehr weit weg ist und auf einem Fußballplatz steht. Das Bild ist heimlich aufgenommen worden. Da wissen wir aus der Überlieferung, dass es sich um die Deportation von Juden und Jüdinnen nach Zamość im April 1942 handelt. Wenn man aber nur das Foto betrachtet, entspricht das nicht dem Bild, das man im Kopf hat, wenn man an Deportation denkt.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass viele Menschen, die heute die Fotos von Zeitzeugen durchschauen, gar nicht wissen, was sie sehen?
Ja. Und ich habe auch noch ein weiteres Beispiel. Aus Eisenach gibt es eine ganze Bilderserie. Auf einem der Fotos, die der Stadtfotograf gemacht hat, mischen sich die zu Deportierenden vor dem Haupteingang des Bahnhofs mit den Passanten. Wenn man in der kompletten Serie nicht sähe, dass die Menschen auf anderen Fotos bewacht werden, sie einen Judenstern tragen und sie viel Gepäck haben – auf einem Bild sieht man sie sogar einsteigen – käme man bei diesem einen Zwischenfoto mit den Passanten überhaupt gar nicht darauf, dass es sich um eine Deportationsszene handelt. Manche Fotos sind auch recht verwackelt. Da muss man lange suchen, um herauszufinden, was eigentlich zu sehen ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24
Sendung: Abendschau, 27.02.2022, 19.30 Uhr