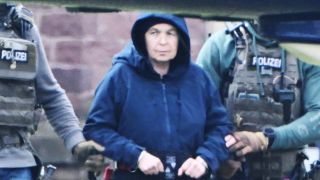Interview | Berliner Missionswerk über internationale Gemeinden - "Wir sollten uns mehr öffnen"

Berlin gilt als eine gottlose Stadt. Doch jedes Wochenende feiern dort Tausende Christen aus allen Teilen der Welt ihren Gottesdienst. Von ihnen können die deutschen Gemeinden einiges lernen, sagt Christof Theilemann, Direktor des Berliner Missionswerks.
rbb: Herr Theilemann, die kirchliche Landschaft in Berlin ist vielfältig und unübersichtlich. Können Sie einen groben Überblick geben?
Christof Theilemann: Wir haben hier etwa 180 christliche Gemeinden verschiedener Sprache und Herkunft. Es gibt US-amerikanische Gemeinden, Skandinavier, Briten und Franzosen, die schon länger hier sind. Viele osteuropäische orthodoxe Kirchen sind recht groß und wachsen weiter. Es gibt alt-orientalische Kirchen, also Syrer oder Kopten. Dann gibt es die Freikirchen, darunter international gemischte Gemeinden, in denen Englisch gesprochen wird. Alle paar Monate entsteht eine neue englischsprachige Gemeinde in Berlin. Dann gibt es viele Kirchen, in denen die Herkunft die Gemeindeglieder vereint. Wir haben allein 13 nigerianische pfingstkirchliche Gemeinden und sieben bis zehn koreanische Gemeinden in Berlin.
In einigen deutschsprachigen Gemeinden wird der Gottesdienst mit 20 Menschen gefeiert. In der polnischen Gemeinde ist sonntags ein richtiger Menschenauflauf. Was ist da anders?
Ich kenne eine eritreische Gemeinde, die Ostern mit 500 bis 700 Menschen feiert - und das die Nacht durch. Ich denke schon, dass in anderssprachigen Gemeinden die Bindung stärker und der Gottesdienstbesuch selbstverständlicher ist. Oft steht auch die ganze Gemeinde hinter dem Kirchenprojekt, anders als in unseren deutschsprachigen Gemeinden. Vielleicht weil das eigene Wohl und Wehe stärker davon abhängt.

Es gibt auch syrische Gemeinden in Berlin. Welche Bedeutung hat Kirche da für ihre Mitglieder?
Es ist auch ein Netzwerk. Als die Geflüchteten aus Syrien kamen, gab es viele Fragen: Wo bringt man sie unter? Wie kann man sie unterstützen? Was die syrischen Gemeinden da geleistet haben, ist unglaublich. Einige Gemeinden sind um die Hälfte gewachsen. Zum Beispiel die Rum-Orthodoxen, das sind Arabisch sprechende Christen. Oder auch die Syrisch-Orthodoxen. Sie sprechen Aramäisch, also die Sprache, die Jesus und seine Jünger gesprochen haben.
Haben die Gottesdienste in den muttersprachlichen Gemeinden einen eigenen Charakter?
Wenn man in einen afrikanischen Gottesdienst geht, dann wird getanzt, es geht lebendig zu. Das würde man manchen unserer Gemeinden auch wünschen. In der koreanischen Hanin-Gemeinde in Moabit schallt aus jedem Raum hochklassige Musik. Vor ein paar Jahren haben die koreanischen Gemeinden dieser Stadt den "Messias" von Händel aufgeführt - mit eigenem Dirigenten, Orchester, Solistinnen und Chören. Das war unglaublich gut.
Es gibt ja auch Kirchen, die unseriös erscheinen, bei denen man den Eindruck hat, das ist eher eine Einrichtung, um Geld zu sammeln für undurchsichtige Zwecke. Oder pfingstkirchliche Gemeinden, die zweifelhafte Heilungszeremonien oder Teufelsaustreibungen vornehmen. Wie geht man damit um?
Das muss man jeden Fall für sich nehmen. Ich kann mir Fälle vorstellen, in denen für eine Zusammenarbeit jede inhaltliche Basis fehlt. Etwa wenn die Selbstbestimmtheit von Menschen nicht geachtet wird. Es gibt auch Kirchen, die schon Getaufte ein zweites Mal taufen. Das geht für uns natürlich nicht. Der Kontakt ist wichtig. Wenn sich eine Gemeinde jeglicher Zusammenarbeit mit der Ökumene verschließt, ist es schwierig für uns.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass es immer mehr evangelikale Gruppen gibt, die Heilung versprechen und mit suggestiven Methoden arbeiten. Stimmt das?
Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich gibt es jedoch das Problem in unserer Gesellschaft, dass Menschen meinen, man könne komplexe Probleme mit einfachen Antworten bearbeiten. Solche Tendenzen gibt es auch in Kirchengemeinden. Wenn man dies beobachtet, muss man sehr aufpassen.
Die traditionellen deutschen Kirchen schrumpfen. Viele Migrantengemeinden wachsen. Was bedeutet das für die Zukunft?
Wir sollten uns diesen Menschen viel mehr öffnen, sie einbeziehen in die Arbeit im Gemeindekirchenrat. In den koreanischen Gemeinden gibt es etwa viele junge Leute, die deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sind, fließend Deutsch und nicht so gut Koreanisch sprechen. Hier sollte unsere Kirche gemeinsam mit diesen Gemeinden schauen, wo es hingeht.
Wir können von jeder dieser Gemeinden etwas lernen. Von den Briten den Pragmatismus. Von den Afrikanern die Freude am Glauben. Von den ostasiatischen Gemeinden die Fähigkeit zum Konsens. In Deutschland sind wir manchmal sehr direkt mit Kritik. In Ostasien achtet man auf einen höflichen Umgangston, der bei uns in der politischen Diskussion ein bisschen verloren gegangen ist.
Man kann viel erfahren aus den Geschichten, die die Menschen mitbringen. Und das Gefühl, dass man als Christ in einer großen Familie zu Hause ist, begeistert mich.
Das Interview führte Ursula Voßhenrich, Redaktion Gesellschaft und Religion