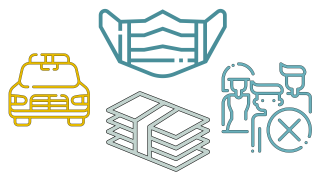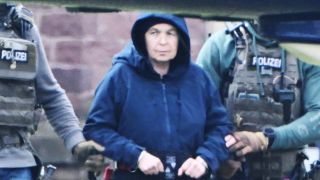Eindämmung der Epidemie - Was Studien über die Wirkung von Corona-Maßnahmen verraten

Seit mehr als sechs Monaten kämpft die Welt mit verschiedenen Maßnahmen gegen Corona. Einige Studien bieten nun erste Hinweise darüber, wie man die Neuinfektionen niedrig halten könnte. Doch es bleiben auch Unsicherheiten. Von Haluka Maier-Borst
Was hilft? Es ist eine scheinbar einfache Frage, die sich Bezirksverordnete in Friedrichshain-Kreuzberg genauso stellen wie Staatschefs in Paris und Tokio. Es ist eine Frage, die Forscherinnen und Forscher genauso umtreibt wie Barbesitzer und Barbesitzerinnen. Die Antwort ist nicht simpel.
rbb|24 hat trotzdem versucht die Frage nach dem Effekt von Maßnahmen zu beantworten und sich dafür auf zwei Studien konzentriert, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die eine Studie ist von Jan Brauner von der Universität Oxford und seinen Kollegen [medrxiv.org], die sich die relative Wirkung von acht Maßnahmen in 41 Ländern, hauptsächlich aus Europa, anschaute. Die andere Studie ist von Peter Klimek von der Universität Wien und Kollegen [medrxiv.org], die sich 46 Maßnahmen in 76 Regionen angeschaut haben. Zu diesen 76 Regionen gehörten viele europäische Staaten aber auch einzelne Bundesstaaten in den USA. Klimeks Team hat zudem die Effekte mit drei statisitischen Methoden untersucht, um alle Eventualitäten abzubilden.

Von Ausgangssperren bis zur Bahnsteigdesinfektion
Die Liste der untersuchten Maßnahmen reichte dabei von Aufklärungskampagnen bis hin zu landesweiten Ausgangssperren, von Reisewarnungen bis hin zum Desinfizieren von Bahnsteigen und Zügen. Die Forscherteams weisen allerdings darauf hin, dass ihre Arbeiten nicht dem klassischen Goldstandard von kontrollierten Studien entsprechen. Denn es ließ sich nicht in einem Land bewusst eine Maßnahme durchführen und im einem anderen nicht. "Uns bleibt nur darauf zu schauen, welche Länder welche Maßnahmen wann durchgeführt haben und wie sich im Anschluss die Infektionszahlen verändert haben. Und das heißt, wir können nie alle Einflussfaktoren im Blick haben", sagt Brauner.
Beide Studien sind zudem noch nicht in wissenschaftlichen Journalen erschienen. Wir haben uns die Ergebnisse darum sowohl von den Autoren selbst als auch von drei unabhängigen Experten einschätzen und ergänzen lassen. Außerdem berechnen diese Studien nicht die Kosten und möglichen Schäden von Maßnahmen mit ein. Deswegen haben wir auch noch einmal separat die fünf Expert/innen gefragt, wozu sie derzeit raten würden. Das Ergebnis dieser nicht-repräsentativen Kurzumfrage können Sie hier lesen.
Viel hilft viel – aber muss es so weit kommen?
Was sich in den beiden Studien und auch in vielen anderen wissenschaftlichen Publikationen zeigt: Viel hilft viel. Drastische Maßnahmen führen auch zu einer starken Senkung des viel besprochenen Reproduktionsfaktors R, der angibt wie viele Menschen eine Infizierte Person ansteckt. So sagt Peter Klimek von der Universität Wien: "Ein Lockdown ist die Maßnahme, die die Infektionen am drastischsten stoppt. Aber es ist halt auch die 'nukleare' Option."
Entsprechend schauen die Forscherinnen und Forscher darauf, welche Einzelmaßnahmen, die zu den verschiedenen Lockdowns gehörten, einen großen Effekt hatten. Zum Beispiel zeigt sich, dass eine Ausgangssperre kaum mehr bringt, wenn bereits fast alle Geschäfte geschlossen sind. Bemerkenswert ist aber vor allem, wie groß der Effekt der viel diskutierten Schulschließungen ist – und zwar sowohl in Klimeks als auch in Brauners Studie.
Falls Ihnen die Grafiken nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.
"Wir vermuteten eigentlich schon im Mai anhand unserer Forschung, dass Schulschließungen sehr effektiv sind, weil meistens im Anschluss an die Schließungen die Neuinfektionen abnahmen. Als wir das aber gesagt haben, gab es Kritik, weil man bei Nachverfolgungsstudien selten Kinder in der Infektionskette gefunden hat.", sagt Jan Brauner von der Universität Oxford. Das sei aber eigentlich gut zu erklären, sagt der Forscher, der sowohl einen Hintergrund in Informatik als auch Medizin hat. Im März, April sei man in den meisten Ländern so überlastet gewesen, dass man gar nicht alle Kontakte nachverfolgen konnte. Und als dies wieder ging, waren die Schulen zu. Entsprechend hätten sich Kinder kaum anstecken können.
Sein Wiener Kollege Klimek gibt aber zu bedenken, dass es Sinn machen würde, zuerst vor allem ältere Schüler ins Homeschooling zu schicken. Andere Studien [nejm.org] würden nämlich nahe legen, dass vor allem die Teenager und jungen Erwachsenen das Virus weiterverbreiten. Und: es gibt eben auch andere Maßnahmen, die ähnlich wirksam sind - zum Beispiel das Beschränken von Treffen auf maximal zehn Personen.
Zehn Prozent weniger Infektionen würden wohl schon reichen
Die Hoffnung vieler Forscher/innen und Politiker/innen ist zudem, dass mit schwächeren Maßnahmen wie Maskenpflicht, Verboten von Großveranstaltungen und freiwilligen Einschränkungen sich die Zahl der Neuinfektionen wieder senken lässt.
Bei solchen schwächeren Maßnahmen fällt jedoch ein Aspekt besonders ins Gewicht: die Unsicherheit. So sagt der Mediziner Zeshan Qureshi vom King's College London, dass Analysen wie die aus Wien und Oxford großartig seien. Aber man müsse beachten, dass es nicht reiche nur auf die Durchschnittswerte für die Effekte der Maßnahmen zu schauen.
"Je nachdem wie sehr sich Leute an neue Regeln halten oder wie sehr sich Maßnahmen ergänzen, können die Effekte ganz anders sein", sagt Qureshi. Entsprechend geben beide Studien jeweils sogenannte Konfidenzintervalle an. Dieser Bereich berücksichtigt also, dass der Effekt der selben Maßnahme in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich groß war.
rbb|24 hat entsprechend für beide Studien die Effekte der Maßnahmen nach einem "Worst Case"- und einem "Best Case"-Szenario geordnet. Das "Worst Case"-Szenario betrachtet einmal das obere Ende dieser Konfidenzintervalle, wenn also R kaum sinkt und damit die Zahl der Neuinfektionen weiter wächst. Das "Best Case"-Szenario widmet sich dem unteren Ende der Konfidenzintervalle, wenn also R deutlich und damit die Zahl der Neuinfektionen sinkt.

Im "Worst Case" hilft die Maskenpflicht kaum
Geht man vom Worst Case aus, so bringen zum Beispiel laut den Studien Maskenpflicht und das Beschränken von Veranstaltungen auf maximal 100 Personen wenig. Auch Reisewarnungen und Vorsichtsmaßnahmen im öffentlichen Nahverkehr könnten pessimistisch gerechnet fast keinen Effekt haben. Ein Grund für diese schlechten Werte der Maßnahmen sind nicht nur die statistischen Unsicherheiten – sondern auch, dass es neben der Maßnahme selbst auch auf das Timing und den Kontext ankommt.
Jan Brauner von der Universität Oxford erklärt das an Hand des Beispiels der Maskenpflicht. "Wenn man viele andere Dinge erlaubt, sollte man die Masken haben. Wenn natürlich in einem Lockdown eh fast alle zu Hause sind, braucht es keine Maskenpflicht", sagt er.
Der Schweizer Epidemiologe Benjamin Steinegger von der Rovira i Virgili Universität in Tarragona sieht es ähnlich. Bei vielen Maßnahmen hänge der Effekt stark davon ab, wie viel Verständnis in der Bevölkerung es gebe und wie früh man agiere. "Wenn aber die Neuinfektionen schon rapide steigen, geht es irgendwann nicht mehr ohne Lockdown – zumindest wenn man einen Kollaps der Kliniken vermeiden will", sagt er. Andersrum gebe es aber auch die Möglichkeit durch viel Kommunikation und simple Maßnahmen, es gar nicht so weit kommen zu lassen.
Im "Best Case" reicht viel Kommunikation
Steinegger ist kein Befürworter von möglichst rigiden Maßnahmen. "Ein Polizeistaat, der schaut, ob sich die Leute überall an die Maßnahmen halten, das bringt nicht viel und ist auch nicht das, was man will. Das Wichtigste ist die Einsicht der Leute", sagt er. Ähnlich sieht es auch der Österreicher Klimek basierend auf der Studie seines Team.
"Gute Risikokommunikation kann fast genauso wirksam sein wie ein mit Polizeikontrolle durchgesetzter Lockdown", sagt er. Außerdem zeige sich, dass Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld, Soforthilfen und dergleichen eben nicht nur wirtschaftlich helfen - sondern auch beim Infektionsgeschehen. Das könnte zum Beispiel so sein, weil Leute sich dann eben nicht kränkelnd zur Arbeit schleppen und andere anstecken.
Auch Brauners Studie legt nahe, dass zum Beispiel das zeitweilige Schließen lediglich von Risiko-Geschäften wie Bars und Clubs schon viel bringen kann.
Insgesamt sei die Hoffnung, so Klimek, dass man in der nächsten Phase der Epidemie in Europa "nicht den Lockdown-Hammer braucht, sondern mit dem Skalpell agieren kann". Das bedeute aber, früh, regional und gezielt zu reagieren.
Eine dafür wohl entscheidende Maßnahme ist nach einhelliger Expertenmeinung das Contact-Tracing oder zu deutsch Kontaktnachverfolgung. Genau diese Maßnahme ist aber in der Studie von Brauner gar nicht enthalten und zeigt in Klimeks Arbeit sogar einen negativen Effekt auf die Fallzahlen. Das hat seine Gründe.
Für Brauners Team waren die Daten zum Contact-Tracing zu lückenhaft, um sie in der Studie einzuschließen. Und der negative Effekt in Klimeks Studie erklärt sich dadurch, dass das Nachverfolgen von Kontakten zunächst einmal Fälle findet, die sonst unentdeckt geblieben wären.
Rein zahlenmäßig steigt also durch intensiviertes Contact-Tracing erst einmal die Zahl der Neuinfektionen. Langfristig ermöglicht es aber das Senken des R-Werts und damit das Eindämmen der Epidemie. Um das zu zeigen, hat Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen sich dezidiert mit der Kontaktverfolgung auseinandergesetzt. Die gelernte Physikerin und ihr Team haben dafür in einer Modellierungsstudie vereinfacht gesagt den Weg zu einem R unterhalb von 1 in zwei Schritte geteilt.
Gesundheitsämter können einen guten Teil der Arbeit erledigen – wenn die Zahlen niedrig sind
Der erste Schritt ist, dass Menschen grundsätzlich weniger andere Menschen anstecken, indem sie sich an Hygiene-Regeln halten, weniger Leute treffen als vor der Pandemie und dergleichen. Der zweite Schritt ist das Tracing durch die Gesundheitsämter. Wenn jemand sich doch ansteckt und andere infiziert, kann das Tracing dafür sorgen, dass ein guter Teil seiner Kontaktpersonen sich rechtzeitig isolieren – bevor sie wieder andere anstecken.
"Grob gesagt müssen wir alle mit unserem Verhalten das R für Corona, das bei 3 bis 4 ohne Maßnahmen liegt, 'nur' auf 2 herunterbringen. Den Schritt von 2 auf unter 1, das können die Gesundheitsämter mit dem Tracing leisten – wenn es eben nicht zu viele neue Fälle gibt und die Leute dort mit der Nachverfolgung hinterherkommen", sagt Priesemann.
Wo genau diese Grenze der Nachverfolgbarkeit liegt, darauf möchte sich Priesemann nicht festlegen. Die derzeit geltende bundesweite Regelung von 50 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sieht Sie aber als zu hoch an. Und: je früher mit Corona infizierte Leute gefunden werden, desto besser.
"Wenn wir jemanden positiv testen noch bevor er Symptome hat, dann haben wir 5-6 Tage um alle seine Kontaktpersonen isolieren. Wenn jemand sich erst nach dem Einsetzen der Symptome testen lässt, haben wir nur 2-3 Tage", erklärt Priesemann.
Es gilt also beim Contact-Tracing das Mantra, das auch für die anderen Maßnahmen gilt: Je früher man agiert, desto mehr hilft es.