#Wiegehtesuns? | Intensivpflegerin auf Covid-Station - "Unter diesen Arbeitsbedingungen habe ich es nicht mehr ausgehalten"

Intensivkrankenschwester war immer ihr Traumberuf. Aber nach zehn traumatischen Monaten auf einer Covid-Intensivstation in Berlin hat Marie K. ihren Job aufgegeben. Sie erzählt, wie es so weit kommen konnte. Ein Gesprächsprotokoll.
Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, wie ihr Alltag gerade aussieht – persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Marie K. ist 26 Jahre alt und hat drei Jahre lang als Intensivpflegerin in einem Berliner Krankenhaus gearbeitet. Wer ihr Arbeitgeber war, darf sie nicht preisgeben. Die Intensivpflege war für sie immer ein Traumberuf. Aber nach ihrer Ausbildung erlebt sie im Berufsalltag eine herbe Enttäuschung. Zeitdruck, Stress, Überforderung – und ihr bleibt kaum Zeit für die Patienten. Vielen ihrer jungen Kollegen geht es ähnlich. Noch schlimmer wird die Situation, als die Pandemie in Berlin ausbricht und sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege weiter verschärfen. Marie arbeitet auf einer Covid-Station am Rande ihrer Belastungsgrenze – bis sie nicht mehr kann. Nach langem Ringen kündigt sie. Hier erzählt sie, wie es ihr heute mit ihrer Entscheidung geht:
Ich dachte, ich hätte versagt. Ich hatte furchtbare Schuldgefühle. Mir ging immer wieder durch den Kopf: Marie, jetzt hast du gekündigt, jetzt müssen andere deine Arbeit machen. Du lässt deine Kolleginnen mitten in der Pandemie im Stich. Im Januar und Februar konnte ich kaum darüber sprechen und habe viel geweint. Ich war körperlich und psychisch am Ende.
Nach meinem letzten Arbeitstag am 17. Dezember 2020 habe ich meine Arbeitsschuhe und mein Stethoskop mit nach Hause genommen und in eine Schublade gesteckt. Ich habe sie monatelang nicht mehr aufgemacht. Ich brauchte Abstand zu allem, was mich an die Covid-Station erinnert hat. Wenn ich mein Stethoskop jetzt aus der Schublade heraushole und es mir um den Hals lege, fühlt es sich fremd an. Als dürfte ich es gar nicht mehr besitzen.
Dabei wollte ich immer Intensivpflegerin werden. Es war mein absoluter Traumberuf. Aber schon vor Corona habe ich mit dem Job gehadert. Denn all die Probleme in der Pflege, die 2020 umso sichtbarer wurden, die gab es ja schon vorher. Dass die Leute uns plötzlich wahrgenommen und für uns geklatscht haben, fanden wir heuchlerisch. Wir waren ja schon vor Corona da und unsere Probleme auch.
Als ich 2018 nach meiner Ausbildung 2018 in den Job gestartet bin, war ich motiviert und idealistisch. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich die Patienten nicht so pflegen konnte, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe. Ich bin von A nach B gehetzt, konnte ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden. Außerdem war ich mir bei Vielem unsicher und oft überfordert von den komplexen Aufgaben. All die hochkomplizierten Geräte und Abläufe. Jeder Handgriff muss sitzen, denn das Leben von schwerkranken Patienten hing davon ab.
Was mache ich, wenn es hier piept? Was mache ich, wenn es dort piept? Die Einarbeitung war oft zu oberflächlich, ich wusste vieles noch nicht. Das hat bei mir eine extreme Unsicherheit ausgelöst, die mich gelähmt hat. Ich hatte ständig Angst, etwas falsch zu machen. Ich wurde einfach so hineingeworfen in den Beruf. Und habe mich mit der Verantwortung für schwerkranke Patienten alleingelassen gefühlt. Ich wurde nicht ausreichend professionell begleitet.
Ich hatte einen großen Wissensdurst, wollte mich verbessern und Fortbildungen machen. Aber oft konnten mir Kollegen nur kurz etwas bei Schichtwechsel erklären. Wegen des Personalmangels war keine Zeit für ausführliche Schulungen. Wenn ich einen Kurs mache, falle ich ja auf Station aus. Bei einem System, das sowieso schon auf Kante genäht ist, ist es extrem schwierig, Kollegen zu entbehren, weil sie natürlich am Patienten gebraucht werden. Nach Feierabend habe ich fieberhaft in Fachbüchern gelesen, um möglichst viel dazuzulernen.
Und dann kam der März 2020. Von heute auf morgen war meine Intensivstation eine Covid-Station. Unsere Aufgaben haben sich weiter verdichtet. Selbst erfahrene Pflegekräfte kamen an ihre Grenzen. Belastung, Überforderung, Dauerstress. Während der Schichten habe ich meine Grundbedürfnisse – Trinken, Essen, auf Toilette gehen – hinten angestellt. An angespannten Tagen habe ich erst bei Dienstende gemerkt, dass ich die letzten acht Stunden noch nicht auf Toilette war. Ich hatte es verdrängt.
Gleichzeitig war es eine Zeit, in der ich Hoffnung geschöpft habe. Die Augen der Welt waren auf die Intensivstationen und unsere Arbeit gerichtet. Ich habe gehofft, dass sich endlich etwas tut und die Politik handelt. Aber da wurde ich enttäuscht. Allein schon die mickrigen Corona-Boni, die an Pflegende gezahlt wurden. Im Vergleich zu unserer immensen Verantwortung waren sie lächerlich. Ich glaube, die Unterstützung aus der Gesellschaft war vorbei, als wir gestreikt haben. Als wir Forderungen nach mehr Gehalt gestellt haben. Vielleicht hätten wir mit dem Klatschen zufrieden sein sollen, vielleicht war das das höchste der Gefühle.
Im Sommer habe ich überlegt, alles hinzuschmeißen. Aber ich dachte mir: Komm, reiß dich zusammen und mach weiter. Du wirst gebraucht. Ich wollte ja mein Team nicht hängen lassen. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Im Herbst habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gekündigt. Am Ende war es die Summe aus allen Belastungen. Auch dass ich gemerkt habe, dass sich gesellschaftlich nichts ändert, dass Pflege so erscheint, als seien wir nur Hinternabwischer. Unsere Professionalität wurde nicht gesehen.
Am Anfang haben mich meine Schuldgefühle ziemlich fertig gemacht. Gleichzeitig wusste ich auf einer rationalen Ebene, dass ich nicht allein bin. Ich kenne viele andere junge Pflegekräfte, die auch aufgegeben haben. In meiner Ausbildungsklasse waren wir damals 30 Leute und nur noch vier bis fünf von ihnen arbeiten heute noch in der Pflege. Es macht mich traurig, denn eigentlich müssten wir die Zukunft des Berufs sein. Ich finde es makaber, dass die Pandemie so viele Pflegekräfte in die Kündigung getrieben hat. Aber die Bedingungen sind daran schuld, dass wir aufgegeben haben und nicht wir selbst. Ich studiere jetzt Gesundheitswissenschaften und will mich weiter für die Pflege und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.
Ich brauche noch etwas Zeit, um die traumatischen Momente auf der Covid-Station zu verarbeiten. Aber mittlerweile fühle ich mich nicht mehr schuldig. Schuld ist ein krankes System, das von Anfang an auf Überforderung angelegt ist.
Gesprächsprotokoll: Anna-Maria Deutschmann









































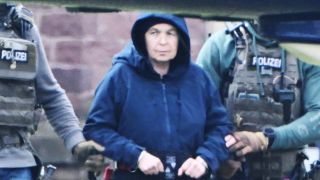



















Kommentar
Bitte füllen Sie die Felder aus, um einen Kommentar zu verfassen.