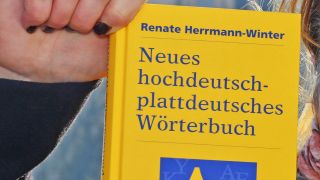Keine Übernahme durch Bund mehr - Was für und gegen das Ende der kostenlosen Corona-Tests spricht

Mit dem 11. Oktober soll das Angebot der kostenlosen Corona-Tests eingestellt werden. Doch was denkt die Forschung über diesen Schritt hier und in anderen Ländern? Ein vorsichtiger Überblick. Von Haluka Maier-Borst
Das Kitzeln, Kratzen, Bohren in der Nase, es wird nicht ganz aufhören. Es werden weiterhin kostenlose PCR-Tests bei Verdachtsfällen durchgeführt. Und es wird sich jeder auch mit eigenem Geld testen lassen können.
Aber die kostenlosen Schnelltests, durchgeführt im leeren Ladenlokal, im Kaufhaus oder gar beim Spätkauf, das wird nun enden. Forscherinnen und Forscher sehen diesen Schritt mit gemischten Gefühlen.
Was für weniger kostenlose Schnelltests spricht
Es gibt durchaus Argumente dafür, wieso Schnelltests nicht mehr denselben Nutzen haben wie vor einigen Monaten. Schon bei Einführung der Schnelltests warnten Expertinnen und Experten davor, dass die Schnelltests zwar gut darin sind, symptomatisch Infizierte zu erkennen. Deutlich schlechter schneiden sie dagegen ab, wenn es um symptomlose Fälle geht [thelancet.com].
Nur ein Drittel der asymptomatischen Infizierten könnte man wohl mit Schnelltests aufspüren, das war das Ergebnis einer Studie der amerikanischen Seuchenbehörde CDC [cdc.gov]. Inzwischen ist das wohl noch schwieriger und zwar wegen einer guten und einer schlechten Nachricht: wegen der Impfungen und der Delta-Variante.
Nach allem, was man weiß, führen die Impfungen nämlich dazu, dass in der Regel selbst bei Durchbruchsinfektionen der Verlauf deutlich milder ist. Das heißt aber meist aber auch, dass die Betroffenen weniger Virus im Rachenraum haben [bmj.com] und wahrscheinlich eher ein Schnelltest sie fälschlich als negativ deklariert. Fraglich ist, ob sie durch diese geringere virale Last, so der Fachbegriff, auch weniger ansteckend sind. So oder so, bei Geimpften sind wahrscheinlich die Schnelltests ungenauer.
Für Geimpfte und auch Ungeimpfte kommt aber auch mit der Delta-Variante noch ein weiterer Faktor hinzu, der das Aufspüren von Infektionen mit Schnelltests schwieriger macht. Die inzwischen dominierende Variante ist wohl fast doppelt so ansteckend [nature.com] wie die ursprüngliche Variante des Virus, der Wildtyp.
Das könnte unter anderem daran liegen, dass zum einen die Viren dieser Variante sich viel schneller vermehren und auch insgesamt eine höhere Virendichte im Rachenbereich zu finden ist. Heißt: Jemand, der vor einigen Stunden noch negativ war, kann sehr schnell infektiös werden und dann auch im schlimmsten Fall deutlich ansteckender werden als jemand, der nur den Wildtyp des Coronavirus hatte. Also ist auch insgesamt die Chance geringer, mit Schnelltests jemanden herauszufischen, der bislang keine Symptome zeigte.
Vor diesem Hintergrund ist es teilweise verständlich, dass man das milliardenschwere Testprogramm herunterfahren will.
Was für ein Beibehalten von kostenlosen Schnelltests spricht
Dem gegenüber stehen andere Überlegungen. Zum einen könnte man durch häufigere Tests hintereinander zumindest das Problem der rapide ansteigenden Infektiösität der Delta-Variante teilweise ausgleichen. Nur wer ist bereit, sich jeden Tag zu testen, wenn es für ihn selbst nicht kostenlos ist?
Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass sich das Dunkelfeld der Infektionen nun deutlich vergrößert. Denn bei allen Schwächen der Schnelltests: gar keine Test zu machen, ist noch riskanter im Hinblick auf das Infektionsgeschehen.
"Die Frage ist ja, was durch den Wegfall der kostenlosen Tests passiert. Ich glaube eher, dass die Impfskeptiker sich gar nicht mehr testen lassen, anstatt dass sie sich jetzt wegen der fehlenden Tests impfen lassen", sagt Peter Kilimek, epidemiologischer Modellierer der Medizinischen Universität Wien.
Klimeks Einschätzung wird auch von Daten gestützt. Die Cosmo-Studie der Universität Erfurt zeigt, dass die Zahl der zur Impfung positiv eingestellten Menschen über die letzten Monate kontinuierlich stieg. Gleichwohl ist der harte Anteil der Impfskeptiker in der Befragtengruppe konstant geblieben.
Entsprechend würde das Weniger an Tests tatsächlich wohl auch zu einem Mehr an unentdeckten Clustern und weniger Überblick führen. Und das könnte ein Problem für eine besondere Gruppe an Menschen sein: die, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Und diejenigen, bei denen die Impfungen nicht genügend wirken.
Denn für diese Menschen bedeutet das Ende der kostenlosen Tests dann wohl, dass die Gefahr, sich unbemerkt anzustecken, größer wird. Und dass sie im Verdachtsfall mehr Mühen auf sich nehmen müssen, um einen Schnelltest zu bekommen.
Klimek sieht darum eigentlich nur einen Weg, dieses ethische Dilemma zu vermeiden. Zum einen müssten vorerst Tests kostenlos bleiben und auch besser werden. So habe Österreich beschlossen, dass bis Ende März die Tests kostenfrei bleiben. Außerdem schwenke man zunehmend in der Teststrategie von den Antigen-Tests auf die besseren PCR-Gurgeltests um.
Zum andrenmüssten sich aber eben mehr Menschen impfen lassen. "Es hängt an den Impfungen, das ist die Lösung und das ist klar", sagt Klimek. Das beste Argument dafür seien eben mehr Freiheiten wie Konzerte, Ausstellungen und andere Dinge, die auch mit Tests nur mit Impfung zugänglich wären. Und eben nicht das grundsätzliche Verwehren von Tests.
Sendung: Abendschau, 10.10.2021, 19:30 Uhr