Probleme bei Eindämmung und Impfung - Virus-Variante B.1.1.7 auf dem Vormarsch - was das bedeutet
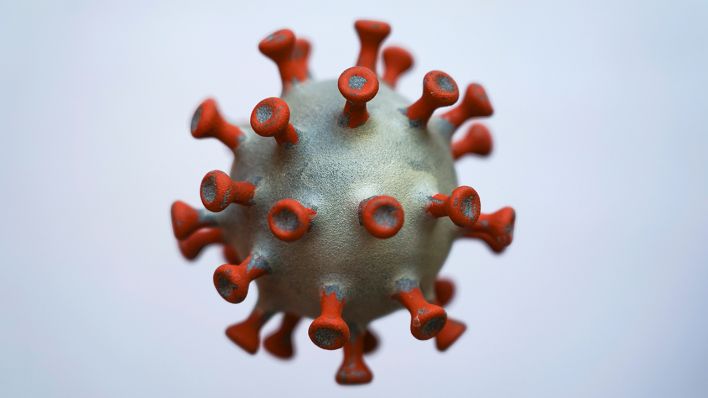
In rund einem Viertel aller Berliner Proben aus Kliniken findet sich die sogenannte britische Mutante des Coronavirus. Die Eigenschaften dieser und anderer Virus-Varianten könnten die Öffnungspläne für den März erheblich gefährden. Von Haluka Maier-Borst
Monate an Lockdown light und Lockdown 2 liegen hinter uns. Die einst (zu) fern geglaubte Inzidenz von 50 Covid-19-Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, sie scheint greifbar. Doch nun gibt es eine neue Unsicherheit: die Mutationen des Corona-Virus und vor allem die Variante B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt worden war, bereiten Politikerinnen und Politikern, Forscherinnen und Forschern Sorge. Denn aktuelle Studien und Datenauswertungen lassen weitere Probleme erahnen.
Wie weit verbreitet sind die Mutationen inzwischen?
Seit Anfang des Jahres versuchen das Robert-Koch-Institut und die verschiedenen Labore in Deutschland im Blick zu behalten, wie verbreitet die verschiedenen Mutationsvarianten sind. Vorläufige Analysen zeichnen nun das Bild, dass die zuerst in Großbritannien festgestellte Variante inzwischen bundesweit 22,8 Prozent aller Proben ausmacht [rki.de], in Berlin sogar wohl 28 Prozent [laborberlin.de] bei den Kliniken. Heute teilte die Gesundheitsverwaltung des Senats allerdings mit, dass eine Auswertung für alle Proben in Berlin einen Anteil von 12 Prozent der "britischen" Variante feststellte [berlin.de]. In der Vorwoche waren es rund 10 Prozent gewesen [berlin.de].
Dass also im März diese Variante das Geschehen dominiert, so wie es vielfach befürchtet wurde, erscheint wahrscheinlich. Inwiefern die sogenannte südafrikanische (B.1.351) und die brasilianische Variante (B.1.1.28 P1) auch Fuß fassen, ist aber schwierig abzuschätzen.
Warum sind die Mutationen ein Problem?
Bei der sogenannten britischen Mutation geht man davon aus, dass sie um 30 bis 50 Prozent ansteckender ist. Das ist weniger als die schlimmsten Befürchtungen vor einigen Wochen noch nahelegten, aber immer noch ein deutlicher Zuwachs. Wieso das so ist - dazu gibt es verschiedene Thesen. Eine Auswertung des britischen Statistikamts legt nahe, dass Infizierte mit der Variante B.1.1.7 mehr husten und darum womöglich sie leichter das Virus übertragen [ons.gov.uk].
Eine andere These, gestützt durch eine Vorveröffentlichung der Universität Harvard [harvard.edu], geht davon aus, dass mit der Variante B.1.1.7 infizierte Menschen länger noch ansteckend sind und sie daher auch mehr weitere Menschen anstecken. Inzwischen gibt es zudem Hinweise darauf, dass die sogenannte britische Variante auch zu mehr schweren und mehr tödlichen Verläufen führt [gov.uk].
Bei der zuerst in Südafrika festgestellten Variante scheint es so zu sein, dass sie wohl ansteckender ist, aber nicht notwendigerweise tödlicher oder mit mehr schweren Verläufen einhergeht [bbc.co.uk]. Ähnlich ist wohl die Situation auch bei der Variante, die in Brasilien zuerst registriert wurde - über die aber bisher am wenigsten bekannt ist.
Das große Problem bei der "südafrikanischen" Variante und vor allem der "brasilianischen" Variante scheint aber zu sein, dass sich das Virus so sehr vom bisherigen Virustyp unterscheidet, dass sich auch bereits Infizierte anstecken können [washingtonpost.com]. Das könnte mit erklären, wieso im brasilianischen Manaus die Zahl der Krankenhausfälle durch Covid-19 wieder steigt, obwohl Studien nahelegten, die Stadtbevölkerung müsste inzwischen Herdenimmunität haben [spektrum.de].
Lassen sich die neuen Mutationen überhaupt unter Kontrolle halten?
Die Sorge ist, dass aufgrund der höheren Übertragbarkeit der Trend der fallenden Inzidenzen bald passé sein könnten. Sowohl das Datenjournalismus-Team der "Süddeutsche Zeitung" als auch des "Spiegel" haben das in groben Modellen vorgerechnet.
Beide Modellierungen gehen davon aus, dass wenn die Wirkung der Maßnahmen gleich bleibt, die Fälle nach März wieder steigen.
Nun gibt es Argumente dafür, dass das Problem sogar noch größer werden könnte: Zum einen, weil sich mit zunehmender Zeit die Leute weniger an die schon eingeführten Lockdown-Maßnahmen halten. Zum anderen, weil jetzt die Schulen wieder geöffnet werden und dies wohl dazu führen wird, dass es unweigerlich mehr Neuinfektionen gibt.
Es gibt aber auch ein bisschen Hoffnung. Zum einen könnte der saisonale Effekt durch den Frühling, dass die Menschen sich also mehr draußen aufhalten, die Übertragbarkeit ein wenig senken – wenngleich wohl in einem deutlich geringeren Ausmaß als im letzten Jahr. Und auch die sogenannte britische Variante lässt sich, allerdings mit sehr rigiden Maßnahmen, einfangen, wie Zahlen aus Großbritannien zeigen, wo die Variante B.1.1.7 bereits das Geschehen dominiert. Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zu dem, was in Deutschland ab nächster Woche geplant ist: In Großbritannien sind die Schulen nach wie vor geschlossen.
Auch vor diesem Hintergrund plädieren aktuell namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine "No-Covid-Strategie" [ifo.de]. Demnach sollten zunächst die Inzidenzen noch weiter heruntergefahren werden, um mit Kontaktnachverfolgung und anderen Maßnahmen besser das Virus zu kontrollieren. Dann, so das Argument der Wissenschaftler, wäre es auch wieder möglich weitgehend ohne Einschränkungen das öffentliche Leben wieder hochzufahren.
Wie gut wirken die Impfstoffe gegen die Mutationen?
Die Zulassungsstudien der Impfstoffe beziehen sie alle auf den Wildtyp von Sars-Cov-2, also die ursprüngliche Variante. Entsprechend gibt es nur vorläufige Daten dazu, wie gut die Wirksamkeit gegen die neuen Mutationen ist.
Was die in Großbritannien entdeckte Mutation angeht, sind die Nachrichten bisher überwiegend positiv. Zwar zeichnet sich sowohl ab, dass als Reaktion auf eine Infektion mit dieser Variante sich deutlich weniger Antikörper bilden, aber dennoch scheint die Schutzwirkung gegen die "britische" Variante auszureichen – und das sowohl bei Astrazeneca [lancet.com] als auch Biontech-Pfizer [sciencemag.com] und auch bei Moderna [medrxiv.org]. Diffuser ist das Bild, wenn es um die Wirkung gegen die in Südafrika entdeckte Variante geht. Dort sieht es wohl aus, dass zumindest Astrazeneca kaum Schutz gegen symptomatische Infektionen bietet [bbc.com]. Allerdings wurde die Studie dazu nur bei jungen Menschen durchgeführt, die selten schwer an Covid-19 erkranken [medrxiv.org]. Denkbar ist also, dass Astrazeneca zumindest gegen schwere Verläufe auch bei der sogenannten südafrikanischen Variante schützt.
Bei Moderna und Pfizer-Biontech hingegen scheint es so zu sein, dass zwar auch hier die Immunantwort durch die Antikörper schwächer ausfällt als beim Wildtyp - aber stark genug um zu schützen. Sowohl die Moderna-Studie [nejm.org] als auch die Biontech/Pfizer Studie wurden im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht [nejm.org] - beide Studien müssen aber mit Vorsicht beachtet werden, weil sie sich bisher lediglich auf die Antikörper-Reaktionen beim Blut von Patienten unter Labor-Bedingungen stützen. Da sich aber die brasilianische und die südafrikanische Variante ähneln, erscheint es gut möglich, dass beide Impfstoffe auch gegen die Mutation aus Brasilien wirken. Astrazeneca will derweil noch in diesem Jahr einen an die neuen Varianten angepassten Impfstoff herausbringen [bbc.co.uk]. So oder so bleibt aber klar, dass sich das Rennen zwischen Menschheit und Virus aktuell verschärft.
Sendung: Inforadio, 19.02.2021, 11:30 Uhr





























































